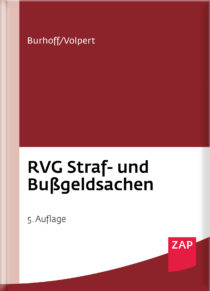Wir lesen das, was wir immer in diesen Fällen lesen, nämlich den Hinweis auf die Rechtsprechung des BVerfG und das Sonderopfer usw. Und weiter:
“Gemessen an diesen Grundsätzen war die durch § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG in den Blick genommene besondere Fallkonstellation in vorliegendem Fall zur Überzeugung des Senats nicht gegeben.
Zu berücksichtigen ist zunächst, dass der Gesetzgeber den Gebührenrahmen für Schwurgerichtssachen gegenüber anderen landgerichtlichen Strafverfahren erheblich höher angesetzt hat und damit dem Umfang und der Schwierigkeit dieser Verfahren bereits bei den Regelgebühren in erheblichem Umfang Rechnung getragen hat. So beträgt die Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag in den allgemeinen Strafsachen vor dem Landgericht, in denen sich der Mandant in Haft befindet, gemäß Nr. 4115 des Vergütungsverzeichnis (VV) 312,- €, bei Schwurgerichtssachen gemäß Nr. 4121 VV 517,- €. Dauert der Verhandlungstag länger als 5 Stunden, beträgt die zusätzliche Gebühr statt 128,- € (Nr. 4116 VV) 212,- € (Nr. 4122 W).
Es ist zwar nicht zu verkennen, dass das vorliegende Verfahren, auch an den besonderen Maßstäben für Schwurgerichtssachen gemessen, sicher umfangreich und angesichts der Problematik um die Würdigung einer Zeugin vom Hörensagen und der Einführung fremdsprachiger TKÜ in tatsächlicher Hinsicht nicht einfach war. Der Tatvorwurf an sich war allerdings sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht überschaubar.
Soweit die Antragstellerin in Ergänzung ihres Antrags einen erheblichen Vorbereitungsaufwand und Aufwand während der Zeit der Hauptverhandlung vorträgt, ist zu bedenken, dass dieser Aufwand durch die Anzahl der Hauptverhandlungstage, durch die die Regelvergütung maßgeblich bestimmt wird, wieder relativiert wird. Gemessen an 114 Hauptverhandlungstagen ist dieser Aufwand relativ gering. Entsprechendes gilt für die Vernehmung von lediglich 70 Zeugen und 5 Sachverständigen bezogen auf 117 Hauptverhandlungstage. Außerdem wurde hier von der Verteidigung der drei Angeklagten offenbar eine einheitliche Verteidigungslinie geführt, was die Möglichkeit der Arbeitsteilung eröffnete. Das zahlreiche wechselseitige Anschließen an die Anträge der jeweils anderen Verteidiger verdeutlicht diese Arbeitsweise. Die von der Antragstellerin als besondere Belastung geltend gemachten Besprechungen mit den anderen Verteidigern ist vor diesem Hintergrund eher als Mittel der Arbeitserleichterung relevant.
Angesichts des überschaubaren Tatvorwurfs konzentrierte sich die weit überwiegende Zahl der Anträge der Antragstellerin auf Indiztatsachen zur Glaubwürdigkeit der Belastungszeugin und der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben sowie Fragen der Richtigkeit der Übersetzungen fremdsprachiger Telefongespräche.
Der Senat verkennt den Arbeitsaufwand, der mit diesen Anträgen verbunden war, nicht. Gleichwohl vermag dieser Einsatz nicht zu erklären, dass sich die Dauer der Hauptverhandlung über 2 Jahre erstreckte und 117 Verhandlungstage in Anspruch nahm. Die Durchsicht des Protokolls ergibt, dass ein wesentlicher Teil der Hauptverhandlung durch Auseinandersetzungen zu Beanstandungen, Würdigungen von Verhaltensweisen von Verfahrensbeteiligten, Fragen der Protokollierung von Äußerungen, insbesondere im Hinblick auf § 183 GVG, Diskussionen zur Protokollierung von Pausen, Auseinandersetzungen um die Reihenfolge bei der Ausübung des Fragerechts und ähnliches geprägt war.
Exemplarisch und zur Verdeutlichung sei hier eine Passage aus dem Hauptverhandlungsprotokoll vom 27. August 2015 wiedergegeben:……
Bei den skizzierten Auseinandersetzungen handelt es sich um solche, die einen erheblichen Teil der Hauptverhandlung in Anspruch nahmen, ihrer Natur nach aber keinen großen Vorbereitungs- und Nachbearbeitungsaufwand bei den Verfahrensbeteiligten erforderten. Vielmehr konnte hier spontan aus der jeweiligen Hauptverhandlungssituation heraus agiert werden. Es dürfte auf der Hand liegen, dass es sich dabei nicht um Problematiken handelt, die einen besonderen Umfang oder eine besondere Schwierigkeit gemäß § 51 RVG für die Antragstellerin begründeten. Die Verhandlungsführung wird in diesen Situationen für die Vorsitzende sicher besonders schwer gewesen sein. Diese Erschwernis lässt sich aber nicht in gleicher Weise auf die Verfahrensbeteiligten übertragen.
Die Belastung durch eine lang dauernde Hauptverhandlung wird auch wesentlich durch die Verhandlungsdichte bestimmt. Es liegt auf der Hand, dass das übliche Geschäft eines Rechtsanwalts im stärkeren Maße bei hoher Verhandlungsdichte im Rahmen einer Pflichtverteidigung leidet. Hier war die Verhandlungsdichte unterdurchschnittlich. Sie betrug auf den Gesamtzeitraum bezogen lediglich 1,1 Tage pro Woche. In diesem Zeitraum gab es auch keine vorübergehend hohe Konzentration der Verhandlungsdichte, die die Aussagekraft dieses Durchschnittswerts relativieren könnte. Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Hauptverhandlungstage lediglich bis zu 3 Stunden dauerte, was den Aufwand zusätzlich relativiert.
Die Antragstellerin hat, wenn auch in geringem Umfang, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich bei Verhinderung vertreten zu lassen. Auch insofern konnte sie ihren eigentlichen beruflichen Verpflichtungen nachgehen.
Nach allem erscheint es dem Senat angesichts der Regelpflichtverteidigergebühren in Höhe von 69.216,- € nicht als unbillig, es bei diesen zu belassen. Von einer Unzumutbarkeit der gesetzlich bestimmten Gebühren kann keine Rede sein.”
Tja, das war es dann. Was bleibt, ist zunächst die Frage: Was verneint das OLG denn nun eiegntlich? War das Verfahren nicht besonders umfangreich/besonders schwierig oder sind die gesetzlichen Gebühren nicht unzumutbar i.S. des § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG? Da geht es in dem Beschluss ein wenig durcheinander, zumindest ist das nicht klar zu erkennen. Ich tendiere zu “nicht unzumutbar”. Und dann die Frage: Kann man noch etwas machen? Sicher, kann man. Man kann Verfassungsbeschwerde einlegen. Nur wage ich die Prognose, dass die nichts bringen wird.
Was für mich darüber hinaus noch bleibt, ist ein leicht säuerlicher Beigeschmack. Das OLG legt im Einzelnen mit der “Passage aus dem Hauptverhandlungsprotokoll vom 27. August 2015″ das Geschehen in der Hauptverhandlung an dem Tag als Beispiel dafür da, dass es in der Hauptverhandlung wohl immer wieder “hoch her gegangen” ist. Abgesehen davon, dass nicht klar ist, inwieweit die antragstellende Verteidigerin an dem Geschehen “beteiligt war – in der vorgestellten Passage ist sie es kaum – hat das für mich so ein wenig den Beigeschmack der Retourkutsche bzw. könnte das die Stelle sein, an der man sich der Rechtsprechung anschließen will, die “unnötige Anträge” bei der Gewährung einer Pauschgebühr nicht berücksichtigen will, was man aber dann lieber doch nicht sagt.
Und wer jetzt kommentieren will: Bitte die gesetzlichen Gebühren nicht auf die erbrachten Stunden umrechnen. Das mögen die OLG ja nun gar nicht.



 .
.