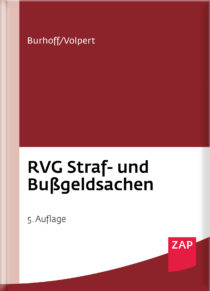So, und hier dann der erste Beschluss zur zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 4142 VV RVG nach den Änderungen der Vermögensabschöpfung zum 1.7.2017. Er kommt vom LG Berlin. Erstritten hat ihn der Kollege Cetinkaya aus Berlin, dem ich für die Übersendung danke.
Im LG Berlin, Beschl. v. 16.01.2018 – 501 Qs 127/17 – heißt es:
„1. Die Entscheidung beruht zu 1. und 3. auf dem Umstand, dass, soweit ersichtlich obergerichtliche Rechtsprechung zu der Frage, ob die Verfahrensgebühr gem. Nr. 4142 VV-RVG auch dann entsteht, wenn die gem. §§ 73, 73c, 73d StGB n. F. angeordnete Einziehung nicht Strafcharakter hat, sondern allein der Entziehung durch die Straftat erlangter unrechtmäßiger wirtschaftlicher Vorteile dient (s. u. zu 2.b.), noch nicht vorhanden ist, und der sich daraus ergebenden „grundsätzlichen Bedeutung“ der zur Entscheidung stehenden Frage, S 56 Abs. 2 S 1 i. V. mit § 33 Abs. 8 S. 2 2. Alt RVG (zu 1.) bzw. § 56 Abs. 2 S. 1 i. V. mit § 33 Abs. 6 S. 1 RVG (zu 3.).
2. Die (der insoweit unzutreffenden Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Beschlusses gemäß) als „Erinnerung“ bezeichnete sofortige Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie fristgemäß erhoben und überschreitet sie die Wertgrenze gem. § 56 Abs. 2 i. V. mit § 33 Abs. 3 S. RVG
a) Das Rechtsmittel ist hinsichtlich der in Ansatz gebrachten Gebühr gem. Nr. 4141 VV-RVG indes unbegründet, weil die Voraussetzungen für die Entstehung des Gebührentatbestands — Entbehrlichwerden der Hauptverhandlung — in hiesigem Verfahren nicht vorliegen. Auf die hilfsweise beantragte Entscheidung über die Erstreckung der Beiordnung auf das bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführte Ermittlungsverfahren – und die Frage, ob dem Verteidiger die hier geltend gemachte Gebühr in jener Sache zusteht, kommt es dabei nicht an.
b) Hinsichtlich der mit dem Kostenfestsetzungsantrag weiter geltend gemachten „Verfahrensgebühr bei Einziehung und verwandten Maßnahmen“ gem. Nr. 4142 VV-RVG ist die sofortige Beschwerde demgegenüber begründet.
Die Voraussetzungen für die Entstehung dieser Gebühr liegen vor, hat sich die Tätigkeit des Verteidigers nämlich auch auf die — bereits mit der Anklageschrift genannte — Einziehung des durch die Betrugstaten erlangten Betrages von 4.139, 12 € bezogen.
Auf den Umstand, dass die angeordnete Einziehung hier schon nicht etwa einen rein „zivilrechtlichen Schadensersatzcharakter“ hat, worauf das Amtsgericht seine Entscheidung stützen will — die durch die Einziehungsentscheidung begünstigte Landeskasse Berlin war durch die Betrugstaten nicht geschädigt worden —, kommt es dabei nicht entscheidend an. Einer Einschränkung des Gebührentatbestands auf solche Einziehungen, die Straf- und nicht nur zivilrechtlichen Schadensersatzcharakter haben, steht hier nämlich der ausdrückliche Wortlaut der (zwingenden) Vorschrift der Nr. 4142 VV-RVG (und gerade der mit der angefochtenen Entscheidung hervorgehobene Umstand, dass der Gebührentatbestand im Zuge der Neufassung der §§ 73 ff StGB durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 nicht ebenfalls geändert worden ist) entgegen.
Dass die in Ansatz gebrachte Gebühr dem Verteidiger nach der vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung geltenden Rechtslage nicht zugebilligt worden wäre, eignet sich nicht, die Versagung des Gebührenansatzes nach neuem Recht zu begründen. Wenn nach der alten, zwischen Verfall und Einziehung unterscheidenden Rechtslage hier nämlich der Verfall von Wertersatz gem. §§ 73, 73a StGB a. F. (sowie das Absehen davon gem. § 73 Abs. 1 S. 2 StGB a. F.) in Frage gekommen und bei der Frage, ob der Verfall des Wertersatzes als i. S. des genannten Gebührentatbestandes der Einziehung „gleichstehende Rechtsfolgen“ anzusehen war, Raum für die vom Amtsgericht vorgenommene Unterscheidung gewesen wäre, ist dies der unterschiedlosen Bezeichnung der Anordnungen gem. §§ 73 ff. StGB n. F. als „Einziehung“ nach der neuen gesetzlichen Regelung nun nicht mehr Fall.
Soweit sich die Bezirksrevisorin des Amtsgerichts für die Versagung des Ansatzes auf die Kommentierung in Gerold/Schmidt/Burhoff RVG 23. Aufl. Rdnrn. 7 und 8 zu Nr. 4142 VV-RVG stützen will, überzeugt dies schon angesichts des Umstands nicht, dass sich die Kommentierung (trotz des im Vorwort aufgenommenen Hinweises auf die Berücksichtigung u. a. des genannten Gesetzes vom 13. April 2017) in den fraglichen Passagen allein auf die alte, nach Verfall und Einziehung unterscheidende Gesetzeslage bezieht (vgl. übrigens Burhoff http://www.burhoff-rvgforum.de/t56f10-Einziehungsgebuehr-Nr-Rechtslage-seit.html: „Wie soll man eigentlich, wenn Redaktionsschluss der 10.7.2017 ist, danach liegende Gesetzesänderungen noch umfassend beachten?“). Die nach dem genannten Kommentar (a. a. O. Rdnr. 6 m. w. Nachw.) für die Anwendung der Nr. 4142 W-RVG entscheidende Voraussetzung, dass es sich um eine Maßnahme handeln muss, die dem Betroffenen den Gegenstand endgültig entziehen und es dadurch zu einem endgültigen Vermögensverlust kommen lassen will, ist demgegenüber hier gegeben.“
Die Entscheidung ist zutreffend. Das LG hat übrigens Recht. Der Kommentar ist an der Stelle nicht ganz eindeutig, bezieht sich aber nicht nur auf das alte Recht……..





 geht es übrigens hier
geht es übrigens hier